
Quellenangabe der Berichte:
* Beipackzettel * 4/2003
* Schmerz * 2/2003

© 2001 Wort & Bild Verlag
Konradshöhe GmbH & Co. KG
Hier kommen Sie zur Homepage des aktuellen Gesundheitsmagazines
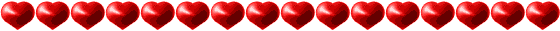 An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich Berichte aus dieser Fachzeitschrift für meine Homepage verwenden darf
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken, dass ich Berichte aus dieser Fachzeitschrift für meine Homepage verwenden darf 
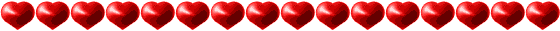
Auf grafische Bild-Darstellungen muss ich aus urheberrechtlichen Gründen verzichten.
 Die Informationen über Arzneimittel verwirren oft mehr, als sie nutzen Die Informationen über Arzneimittel verwirren oft mehr, als sie nutzen
 So lesen Sie den Beipackzettel richtig So lesen Sie den Beipackzettel richtig
|
Beratungskompetenz des Apothekers gefragt
|
| Wenn ich ein bisher unbekanntes rezeptfreies Medikament hole, dann lasse ich mich in der Apotheke informieren über...
|
%
|
| ... die richtige Dosierung
|
78,1
|
| ... die richtige Einnahme
|
73,2
|
| ... die Anwendungsgebiete
|
66,2
|
| .. mögliche Unverträglichkeiten, Nebenwirkungen, Risiken
|
60,2
|
| ... Gegenanzeigen
|
59,8
|
| ... mögliche Wechselwirkungen
|
57,6
|
Quelle: Repräsentativumfrage bei 2.054 Bundesbürgern ab 14 Jahren durch die GfK Marktforschung im Auftrag der Apotheken Umschau
|
Das klingt ja schlimm.
"Helga E. aus Zwickau knüllt den Beipackzettel des soeben in der Apotheke abgeholten Medikaments mit der Hand zusammen".
"Bei den vielen Nebenwirkungen wird mir ja angst und bange", klagt sie - und die Arznei wandert in den Mülleimer.
So wie Helga E. ging es fast jedem zweiten Deutschen schon einmal, wie eine repräsentative Umfrage der Gfk-Marktforschung im Auftrag der Apotheken Umschau zeigte.
48,4 Prozent der Befragten haben aus Angst vor Nebenwirkungen ein verordnetes Medikament nicht eingenommen.
Bei Frauen ist der Anteil der Therapieverweigerer mit 56,7 Prozent besonders hoch, von den Männern haben sich nur 39,3 Prozent schon durch die Angaben zu Risiken und Nebenwirkungen einschüchtern lassen.
Doch der Verzicht kann drastische Folgen haben:
"Unbehandelte Erkrankungen haben schlimmere Auswirkungen als mögliche Nebenwirkungen", weiß Apotheker Dr. Felix Denk aus München.
"Wenn ein Patient ein verordnetes Medikament nicht nehmen will, sollte er sich auf jeden Fall noch einmal an seinen Arzt wenden."
Der Beipackzettel als großer Angstmacher?
So ist es sicher nicht.
Immerhin 72,7 Prozent der Befragten schätzen die Gebrauchsinformation, so die offizielle Bezeichnung des Beipackzettels, als wichtige Informationsquelle.
Das größte Interesse finden bei den Patienten die Angaben zur richtigen Dosierung (88,3%) und Hinweise zur richtigen Einnahme (84,6%).
Erst dann folgen Anwendungsgebiete (82,2 %), Nebenwirkungen (79,6%) und Gegenanzeigen (75,8%).
Die Angaben zum Hersteller des Arzneimittels sind nur für etwa jeden Vierten bis Fünften wichtig (22,5%).
Immerhin drei von vier Patienten handeln vernünftig und bewahren die Gebrauchsinformation so lange auf, wie sie das Medikament einnehmen.
Andere Zahlen stimmen dagegen nachdenklich.
Zum Beispiel ignoriert rund ein Drittel der Befragten den Beipackzettel eines rezeptpflichtigen Arzneimittels, das ihnen vom Arzt verschrieben wurde - selbst wenn sie es zum ersten Mal einnehmen müssen.
Für die Fachleute keine Überraschung:
Insgesamt zeigten sich Frauen in Sachen Arzneimittelinformationen interessierter, kritischer und vorsichtiger als die Männer.
|
Gesetzliche Vorgaben verhindern Klarheit
|
Obwohl Beipackzettel in den vergangenen Jahren allgemein verständlicher und übersichtlicher geworden sind, gibt es bei Patienten noch genügend Verunsicherung.
Am kritischsten beurteilt werden die Fülle an Fremdwörtern sowie die schwere Verständlichkeit der Wechselwirkungen.
Jeder Zweite (54,6%) wünscht sich eine inhaltliche Änderung.
"Hier stecken wir in einem Dilemma, aus dem wir wahrscheinlich nie vollständig herauskommen", meint Dr. Rose Schraitle vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller in Bonn.
"Auch die Pharma-Unternehmen wollen natürlich Fremdwörter und Fachbegriffe möglichst vermeiden, aber da stößt man manchmal an Grenzen.
So werden beispielsweise bei Antibiotika häufig viele Krankheitserreger genannt, gegen die das Medikament wirksam ist.
Diese Erreger haben nun mal wissenschaftliche Namen, die sich nicht übersetzen lassen."
Die Idee, manche der unverständlichen Angaben einfach wegzulassen, sei keine Lösung, glaubt Schraitle.
Der Verbraucher solle und müsse schließlich umfassend informiert werden.
Viele Angaben sind den Arzneimittelherstellern sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Da sich also am Inhalt der Arzneimittelinformationen kaum etwas ändern wird, ist es ratsam, dass Patienten zumindest wissen, worauf sie bei der Lektüre des Beipackzettels ganz besonders achten sollten.
Hier die wichtigsten Hinweise:
Die Inhaltsstoffe müssen vollständig aufgeführt sein.
Unterschieden wird dabei häufig zwischen Wirkstoffen und Hilfsstoffen.
Die Angabe der Hilfsstoffe ("weitere Bestandteile") ist besonders für Allergiker wichtig, die zum Beispiel manche Konservierungsmittel oder Farbstoffe nicht vertragen.
Diese Angabe kann für den Patienten wichtige Hinweise enthalten.
So dürfen beispielsweise Filmtabletten, magensaftresistent überzogene Tabletten oder Kapseln nicht ohne weiteres geteilt werden.
Für Patienten weniger wichtig.
Aus rechtlichen Gründen muss das Unternehmen jedoch genannt sein, um dringende Rückfragen, etwa bei Vergiftungen, zu ermöglichen.
Aufgeführt sind hier sämtliche Anwendungsgebiete ("Indikationen"), bei denen das Medikament wirkt.
Die Voraussetzung ist, dass der Hersteller durch entsprechende Studien die Wirkung nachweisen konnte.
Aber keine Sorge:
Auch wenn Ihnen Ihr Arzt das Mittel verschrieben hat, bedeutet das nicht, dass Sie an all diesen Krankheiten leiden.
Darunter versteht man Krankheiten oder Umstände, bei denen das Medikament nicht angewendet werden darf.
Bei "relativen Gegenanzeigen" kann der Arzt sorgfältig abwägen und dann trotz eines gewissen Risikos zur Einnahme raten.
Bei "absoluten Gegenanzeigen" darf das Arzneimittel auf keinen Fall eingenommen werden.
Wichtig ist, dass Sie Ihren Arzt über alle Krankheiten informieren, an denen Sie leiden oder gelitten haben.
Das gilt übrigens auch, wenn Sie sich ein rezeptfreies Arzneimittel in der Apotheke holen.
Die gleichzeitige Einnahme mehrerer Medikamente kann zu Wechselwirkungen führen.
So können sich beispielsweise zwei Arzneimittel gegenseitig abschwächen oder in ihrer Wirkung verstärken.
Ebenso kann auch die gleichzeitige Einnahme des Medikaments mit bestimmten Nahrungsmitteln oder Alkohol zu Wechselwirkungen führen.
Unter diesem Punkt nennt der Pharmahersteller zusätzlich erforderliche Warnhinweise, zum Beispiel, wenn nach Einnahme des Präparates das Reaktionsvermögen eingeschränkt ist.
In diesem Fall sollten Sie nicht Auto fahren, solange Sie das Medikament anwenden.
Aber auch Hinweise auf enthaltenen Alkohol, Blutbildkontrollen während der
Therapie oder sonstige Verhaltensregeln
werden hier beschrieben.
Beachten Sie, dass hier die Angaben des Herstellers nicht unbedingt mit den Dosierungshinweisen Ihres Arztes übereinstimmen müssen.
Halten Sie sich vorrangig an die Empfehlungen Ihres Arztes.
Im Zweifelsfall fragen Sie ihn besser noch einmal.
Bei Präparaten, die auf nüchternen Magen genommen werden sollen, wird der Hersteller die Einnahme eine halbe Stunde vor oder mindestens zwei Stunden nach dem Essen vorschreiben.
Für Arzneistoffe, die zusammen mit Nahrung besser verträglich sind, empfiehlt er die Einnahme zum oder unmittelbar nach dem Essen.
Befolgen Sie auch den Hinweis "mit reichlich Flüssigkeit einzunehmen".
Mit Leitungswasser oder kohlensäurearmem Mineralwasser machen Sie nichts falsch.
Milch, Kaffee, Cola, Fruchtsäfte und Tee könnten die Wirkung eines Arzneimittels negativ beeinflussen.
Der Hersteller ist verpflichtet, alle Risiken und Nebenwirkungen aufzuführen, die in Zusammenhang mit dem Arzneimittel beobachtet wurden - auch wenn sie noch so selten vorkommen.
Was bedeuten die verschiedenen "Klassifizierungen"?
Tritt eine Nebenwirkung "in Einzelfällen" auf, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 1 Million;
"selten" steht für eine Wahrscheinlichkeit von unter 1 Prozent "Gelegentlich" heißt, dass Nebenwirkungen in bis zu 10 Prozent der Fälle auftreten können;
"häufig": bei mehr als 10 Prozent der Patienten.
Wenn Sie Nebenwirkungen spüren, die nicht aufgeführt sind, sollten Sie sofort Ihren Arzt oder Apotheker darüber informieren.
Er kann dann die entsprechenden Behörden verständigen.
|
Aufklärung und guter Rat sind in der Apotheke inklusive
|
Gerade weil der Beipackzettel häufig schwer verständlich ist, suchen viele Menschen Rat in der Apotheke.
So gaben 78,1 Prozent der Befragten an, sich dort über die richtige Dosierung zu informieren, wenn sie ein ihnen bisher unbekanntes rezeptfreies Medikament kaufen.
Das ist gut, aber:
Nur jeder Zweite (56,5%) fragt gezielt nach, wenn er auf dem Beipackzettel etwas nicht versteht.
Doch genau dafür sind Apothekerinnen und Apotheker da.
Als Arzneimittelfachleute verfügen sie über das entsprechende Wissen und können über ein spezielles Computersystem alle vorliegenden Informationen abrufen sowie Wechselwirkungen überprüfen.
"Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage, und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker" - diese Empfehlung sollte mehr sein als ein gesetzlich vorgeschriebener Warnhinweis!
 In ausländischen "Arznei-Supermärkten" locken oft niedrige Preise. In ausländischen "Arznei-Supermärkten" locken oft niedrige Preise.
|
 Die fremdsprachige Gebrauchsinformation nützt dem Patienten sehr wenig!! Die fremdsprachige Gebrauchsinformation nützt dem Patienten sehr wenig!!
|
|
Wichtige Informationsquelle:
Ich lese den Beipackzettel immer oder meistens (Angaben in %)
|
Bei rezeptpflichtigen Medikamenten...
|
| ... die ich vorher noch nie verwendet habe
|
65,8
|
| ... die ich vorher schon einmal verwendet habe
|
30,2
|
Bei rezeptfreien Medikamenten...
|
| ... die ich vorher noch nie verwendet habe
|
62,7
|
| ... die ich vorher bereits verwendet habe
|
27,6
|
Basis: Alle 2.054 Befragten
|
|


Zurück nach oben |
 |

Suchen Sie Kontakt zu Menschen die ihrem Krankheitsbild entsprechen, um Erfahrungen und Informationen auszutauschen ??
Dann besuchen Sie doch mein neues
Gesundheits-Forum
Sie finden dort auch eine
"Plauderecke für Senioren", sowie etwas für poetische oder witzige Menschen.
Was passiert im Gehirn, wenn es irgendwo im Körper wehtut?
Warum können Schmerzen chronisch werden?
Forscher entschlüsseln eines der letzten Geheimnisse des Menschen
Sie sind ungreifbar und können das Leben eines Menschen dennoch zur Hölle machen.
Wie und warum Schmerzen entstehen, dem kommt die Wissenschaft erst ganz allmählich auf die Spur.
Und so ranken sich noch viele Mythen um das bislang unerklärte Phänomen:
Rothaarige sollen stärker schmerzempfindlich sein als Brünette oder Blonde, alte Menschen weniger als junge.
Zumindest Letzteres konnten Schmerzforscher vor kurzem widerlegen.
Was sie mittlerweile sicher wissen:
Je länger Schmerzen andauern, umso stärker beschäftigen sie unser Gehirn, umso schwieriger sind sie zu behandeln.
Das zeigen Bilder des Gehirns, die mit Hilfe neuer Methoden entstanden sind.
Die Schmerzforscher können dem Gehirn damit zuschauen, wie es Schmerzen verarbeitet - ein Hoffnungsschimmer für die laut Deutscher Schmerzhilfe 7,5 Millionen chronisch Schmerzkranken in Deutschland.
Denn die neuen Erkenntnisse revolutionieren die Schmerztherapie.
|
Schmerz ist ein
notwendiges Warnsignal
|
Akuter Schmerz ist ein Warnsignal, das den Körper zu einer Verhaltensänderung zwingt:
Wer einmal auf eine glühende Herdplatte gefasst hat, wird das wahrscheinlich kein zweites Mal tun.
Aber was passiert, wenn Rücken-, Kopf- oder Nervenschmerzen chronisch werden?
Dann hat das Gehirn einen Lernprozess durchlaufen, in dem sich die Erinnerung an eine Schmerzempfindung tief eingegraben hat und im Hintergrund stets vorhanden ist.
In Erwartung neuer Schmerzerlebnisse ist es in ständiger Alarmbereitschaft.
Und schon beim geringsten Anlass reagiert das Gehirn und signalisiert:
Es tut weh.
|
Die Anpassung der Gehirnzellen macht Schmerz chronisch
|
Grundlage für diese fest zementierte Gedächtnisspur ist die Anpassungsfähigkeit des Gehirns:
Dauern Schmerzen länger an, ändern die Nervenzellen ihre Struktur, um Reize besser verarbeiten zu können.
Zwischen den Nervenfasern sprossen neue Verbindungen, so dass es schließlich ein Überangebot an Verschaltungsmöglichkeiten gibt.
Das Gehirn wird übersensibel:
"Ein Unfall der Natur", meint Prof. ThomasTölle, Oberarzt der Neurologischen Klinik und Poliklinik sowie Leiter der Schmerzambulanz der Technischen Universität München.
Wie dieser Unfall konkret abläuft, hat seine Kollegin Prof. Herta Flor, Neuropsychologin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, untersucht.
Sie prüfte, welche Veränderungen des Gehirns bei Patienten mit Phantomschmerz auftreten.
Ihr Ergebnis:
Die Hirnareale, die Reize aus Hand oder Arm verarbeiten, weiten sich nach der Amputation dieses Körperteils aus.
"Das bedeutet, dass die Reize, die dort ankommen, stärker verarbeitet werden.
Der Patient erlebt auch unwesentliche Nervenimpulse als schmerzhaft."
Die Expertin vergleicht diese Vorgänge mit denen, die ablaufen, wenn jemand Klavierspielen lernt.
"Die Hirnregionen, die die Finger repräsentieren, werden stärker aktiviert, und Sie beherrschen das Instrument deshalb mit der Zeit immer besser."
Bei der Schmerzentstehung wirkt sich diese Lernfähigkeit des Gehirns nachteilig aus.
|
Die Idee eines Schmerzzentrums ist nicht mehr aktuell
|
Was genau abläuft, wenn Schmerzreize aus einer Region des Körpers in der obersten Schaltzentrale ankommen, haben auch Wissenschaftler des Neurozentrums für funktionelle Bildgebung - einem Verbund aus Neurologen, Nuklearmedizinern und Radiologen - an der TU München beobachtet.
Sie können den grauen Zellen dabei zuschauen, wie sie kommunizieren, um gezielt gesetzte Schmerzreize zu verarbeiten.
Schichtaufnahmen bestätigen:
An dem Gesamtsinneseindruck Schmerz ist das ganze Hirn beteiligt.
Denn Ängste, Erwartungen und Bewertungen, die im Vorderhirn, im Zwischenhirn und im Limbischen System, entstehen, beeinflussen die Schmerzwahrnehmung:
Ein (früher angenommenes) einziges "Schmerzzentrum" gibt es nicht.
Die rot und gelb aufleuchtenden Punkte auf den Aufnahmen rechts zeigen, dass verschiedene Regionen des Gehirns bei der Schmerzverarbeitung aktiviert werden.
Sie sprechen quasi miteinander.
Die Bilder belegen auch:
Die Aktivierungsspuren im Gehirn sind bei einem realen, Schmerz auslösenden Hitzereiz und beim Phantomschmerz gleich.
"Schmerz entsteht also praktisch nur im Gehirn", folgert Prof. Tölle.
Die Experten können an den Mustern einer spezifischen Hirnaktivierung nicht ablesen, ob sie durch echte Schädigungen von Nerven, Knochen und Bandscheiben oder "nur" durch Prozesse im Gehirn selbst entstehen.
"Schmerz ist ein individuelles Aktivitätsmuster unseres Gehirns", sagt der Neurologe.
Er ist subjektiv, und jeder Mensch empfindet ihn anders:
Berührungen tun einem Menschen mit Nervenschmerzen höllisch weh, während ein anderer sie kaum wahrnimmt.
Auch wenn es also keine objektive Ursache für chronische Schmerzen gibt:
Für das Gehirn sind sie real.
|
Behandlung mit Medikamenten:
Nur Spezialkombinationen helfen
|
Weil Schmerz das ganze Hirn beschäftigt, ist er nicht mit einem einzigen Arzneimittel auszuschalten.
Mehrere Medikamente müssen so kombiniert werden, dass ihre Wirksubstanzen in den relevanten Regionen gleichzeitig angreifen.
Oft lässt sich auf diese Weise die Gesamtdosis reduzieren.
Durch eine optimale Therapie mit Opiaten, Antidepressiva, Antiepileptika und Wirkstoffen wie NMDA-Rezeptor-Antagonisten können die Umbauprozesse des Gehirns aufgehalten oder teilweise wieder rückgängig gemacht werden.
"Das sind Medikamente, die lernbedingte strukturelle Veränderungen im Gehirn bei chronischen Schmerzen beeinflussen können", sagt Prof. Flor.
Sie greifen aktiv in Verschaltungsprozesse ein, die aus dem Ruder laufen.
Nach jüngsten Untersuchungen Tölles und seiner Kollegen reichen bereits geringste Schmerzeinheiten aus, um im Gehirn eine Gedächtnisspur anzulegen.
"Jede Art von Schmerz kann sich unendlich ausbreiten und die Gesamtverarbeitung bestimmen."
Am besten ist es deshalb, wenn Schmerz gar nicht erst entsteht oder frühzeitig therapiert wird.
|
Wirksame Psycho-Strategie:
Vom Schmerz ablenken
|
Schmerzen haben eine starke psychologische Komponente:
Ihre Wahrnehmung ist eng mit Gefühlen, Ängsten, Erfahrungen und Erwartungen verbunden;
Deshalb setzen die Schmerzforscher darauf, die erlernten Assoziationen des Gehirns mit bestimmten Schmerzempfindungen zu kappen und seine Erinnerung an den Schmerz nach und nach zu löschen.
Erste positive Erfahrungen machte Prof. Flor bei Patienten mit Phantomschmerzen.
"Durch elektrische Stimulation am Stumpf suggerierten wir dem Gehirn, dass aus der von der Amputation betroffenen Region wieder Reize eintreffen.
Wenn ein Unterarm amputiert ist, dann wandern Nervenzuflüsse aus dem Gesicht in die frühere Handregion im Gehirn.
Diese Verschiebung können wir durch das Training wieder rückgängig machen.
Die Repräsentation von Mund und Arm im Gehirn wandert wieder dahin, wo sie eigentlich hingehört."
Die Ablenkungsstrategie funktioniert aber auch ohne elektrische Reize von außen.
Ist jemand mit chronischen Rückenschmerzen stark auf eine Aufgabe konzentriert, blendet er den Schmerz vorübergehend aus.
"Je besser jemand sich ablenken lässt, desto besser ist die Schmerzreduktion, desto stärker die Kraft, die eigene Schmerzabwehr zu aktivieren", sagt Tölle.
"Unsere Aufmerksamkeitssteuerung bestimmt also ganz erheblich, wie jemand seinen Schmerz wahrnimmt.
Deshalb bedeutet Therapie auch Wegwendung vom Schmerz und bewusste Beschäftigung mit anderen Dingen."
Schmerzpatienten können diese Techniken in einer Verhaltenstherapie erlernen.
"Möglicherweise wirken psychotherapeutische Behandlungen genau so gut wie fünf Milligramm Morphium an der richtigen Stelle" , spekuliert der Schmerz-Experte, "und können dadurch das Schmerz-Netzwerk ebenfalls wieder verändern."
Am einfachsten wäre es, Schmerz einfach vergessen zu können.
Tölle verweist auf einen Rückenschmerz-Patienten, von dem in der Literatur berichtet wird.
Er fiel im Verlauf seiner schweren Erkrankung in ein Koma und erwachte erst nach zwei Jahren wieder.
Die Schmerzen waren plötzlich weg.
Denn der Mann erinnerte sich einfach nicht mehr daran.
Das Schmerzgedächtnis war gelöscht.
Bilder vom Schmerz
Positronen-Emissions-Tomographie:
Die Forscher injizieren dem Patienten eine radioaktive Substanz, die an die für die Schmerzverarbeitung
zuständigen Strukturen im Gehirn andocken kann.
So kann man sehen, wo der Schmerzreiz das Gehirn aktiviert beziehungsweise wo die körpereigene
Schmerzhemmung gerade reduziert ist.
Funktionelles Kernspin:
Bei dieser Methode wird der Blutfluss in bestimmten Hirnarealen gemessen.
Aktivierte Bereiche sind besser durchblutet als andere, was sich an der Färbung ablesen lässt.
|
Schmerz-Informationen
gibt es
auch im Internet
www.schmerz-online.de
Homepage der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS).
Umfangreiche Linksammlung zu Schmerzkliniken und Infos im Netz
www.schmerzhilfe.org
Homepage der Deutschen Schmerzhilfe e.V.
Leitfaden zur Schmerztherapeuten-Suche und ausführliches Verzeichnis von Selbsthilfegruppen.
www.neuropathischer-schmerz.de
Homepage des Deutschen Forschungsverbunds Neuropathischer Schmerz.
Informationen über neue Projekte und Ergebnisse in der Schmerzforschung und Teilnahmemöglichkeiten für Schmerzpatienten an wissenschaftlichen Studien.
Besuchen Sie doch mal mein reichhaltiges
* "Gesundheits-Archiv" *
Dort finden Sie noch viele Infos über andere Krankheitsbilder oder vielleicht auch zu den Themen dieser Seite!!

|
|
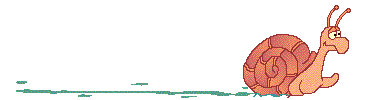
|